In Alternativen zum Auto investieren
Der ADFC hat mit Dr. Weert Canzler, Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin, über das Sondervermögen, die StVG-Reform und skeptische Kommunen sowie über Gamechanger der Mobilitätswende gesprochen.
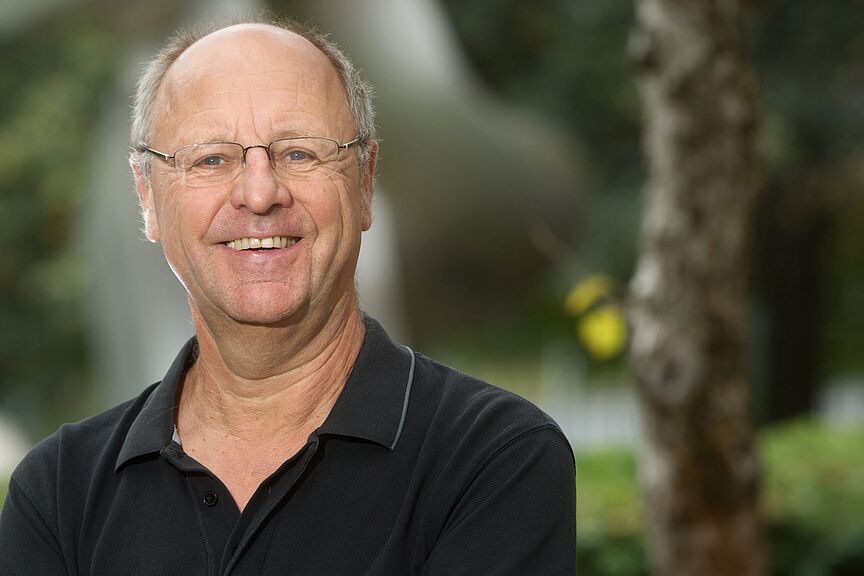
Sind die Milliarden des Sondervermögens nach den bisherigen Planungen gut in die Verkehrsinfrastruktur angelegt?
Leider sind die bisherige Planung und das, was tatsächlich passiert, möglicherweise nicht deckungsgleich. Das ist das Grundproblem beim Sondervermögen. Es gibt zwar vage Absichtserklärungen, die zum Teil gut klingen, aber was dann tatsächlich dabei rauskommt, ist völlig offen.
Die jüngsten Diskussionen, daraus auch Autobahnneubauten zu finanzieren, sind vollkommen kontraproduktiv und mit dem Konsens Anfang des Jahres aus meiner Sicht nicht vereinbar. Es wird sicherlich Versuche geben, Mittel aus dem Sondervermögen für Dinge zu verwenden, die entweder kontraproduktiv sind oder aus dem normalen Haushalt finanziert werden müssen. Da besteht die Gefahr eines Verschiebebahnhofs – und man muss verkehrspolitisch sehr aufpassen.
Wenn Ihnen der Etat zur Verfügung stünde, in welche Bereiche würden Sie besonders investieren?
Ich würde in Alternativen zum individuellen Autoverkehr investieren – also in ein funktionierendes und sicheres Fahrradwegenetz und bessere Fußgängerwege. Ein großes Programm zur Entschärfung von Kreuzungen und zum Umbau bestehender Infrastruktur zugunsten von Rad- und Fußverkehr hätte erste Priorität.
Zweite Priorität wäre die Sicherung der bestehenden Infrastruktur bei Brücken, Tunneln und Straßen – eine vernünftige, vorausschauende Sanierung. Und ich würde ein Moratorium für Neubauten erlassen: Keine neue Straßeninfrastruktur, selbst wenn Planungskosten abzuschreiben sind.
Die Bahn muss massiv ausgebaut werden – vor allem müssen Trassen erneuert und ertüchtigt werden. Das ist ein Riesenprogramm, das sehr lange dauert, weil so lange falsch gespart wurde. Entscheidend ist dabei eine stetige, langfristige Finanzierung, damit geplante Projekte nicht aus budgetären Gründen verzögert werden. Die Struktur der Investitionen muss gerade im Bahnbereich langfristig gesichert sein.
Mit dem reformierten Straßenverkehrsgesetz haben Kommunen viel mehr Möglichkeiten, ihre Infrastruktur lebenswerter zu gestalten. Wird schon danach geplant oder ist das in den Verwaltungen noch nicht angekommen?
Es ist teilweise angekommen. Aber nach wie vor besteht in vielen Kommunen Skepsis, ob das, was nach StVG-Novelle und Verwaltungsausführungsverordnung möglich ist, tatsächlich so rechtssicher ist wie erhofft. Die Befürchtung, dass es doch wieder zu Klagen kommt, die Zeit und Ressourcen kosten, ist nicht aus der Welt. Viele Kommunen sind deswegen vorsichtig, obwohl sie viel mehr machen könnten als vor der Novelle.

Dr. habil. Weert Canzler forscht seit 1994 am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) in der Forschungsgruppe „Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung“. Seine Forschungsschwerpunkte sind Verkehrs- und Mobilitätsforschung, Energiewende sowie Innovationsforschung. Er ist Autor zahlreicher Publikationen.
Bei der Radinfrastruktur gab es gute Ansätze wie Protected Bike Lanes oder Kiezblocks. Aktuell lässt sich oft ein Rollback beobachten. Welche Folgen hat das?
Die Folgen sind in zweifacher Hinsicht fatal: Zum einen wird die notwendige sichere Infrastruktur fürs Fahrrad massiv verzögert, und damit ist die Voraussetzung gefährdet, dass der Fahrradanteil im Modal Split zunimmt.
Zum anderen werden Planer demotiviert, die sich bereits mit konkreten Trassen- und Netzplanungen beschäftigt haben. In Berlin und anderen Kommunen werden diese Planungen nicht ausgeführt, verzögert oder verschleppt. Das ist extrem demotivierend. Im schlimmsten Fall gucken sich Fachkräfte um und gehen woanders hin. Unter der Bedingung von Fachkräftemangel ist es absolut fahrlässig, qualifizierte Planer so zu demotivieren.
Der ADFC-Fahrradklima-Test zeigt, dass Rückschritte bei der Radinfrastruktur sich messbar auswirken. Berlin ist ein Beispiel – vom Mobilitätsgesetz zurück zur Stadtautobahn. Wie wichtig ist politische Stabilität?
Stabilität ist wichtig, weil Planung, Bau und Einführung neuer Angebote länger dauern. Wenn durch Regierungswechsel plötzlich andere Prioritäten gesetzt werden, ist das fatal.
In Berlin haben wir eine Spaltung zwischen Innenstadtbereich und Randbezirken: Der innere Bereich ist fahrradfreundlich und setzt auf die Mobilitätswende. Der äußere Bereich will, dass das Auto weiterhin eine große Rolle spielt. Die Positionen aus den Randbezirken sind mehrheitsfähig geworden und verschärfen die Spaltung noch mal.
International vergleicht sich Berlin gerne mit anderen Städten. Wenn man nach Paris, Kopenhagen, Utrecht, Mailand, Helsinki oder Stockholm schaut, sieht man: Diese Städte sind viel konsequenter beim Zurückdrängen des Autos und beim Abbau seiner Privilegien. Berlin tut so, als könne man weitermachen wie bisher. Das ist im internationalen Vergleich absolut rückständig.
Gibt es neben dem Elektrofahrrad weitere Gamechanger bei der Mobilitätsplanung?
Beim Elektrofahrrad muss es gelingen, es aus der Freizeitecke in den Alltagsverkehr zu bringen. Die Ausstattung ist mittlerweile sehr gut, aber es fehlt an sicherer Infrastruktur an Werktagen und an sicheren Abstellmöglichkeiten an Arbeitsplätzen sowie an Bus- und Bahnhöfen. Ein weiterer Gamechanger ist die Klimakrise. Hitze und Starkregen zwingen Städte zum Entsiegeln. Wien hatte im letzten Jahr über 25 tropische Nächte – also Nächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sank – und viele Hitzetote. Der Druck wird massiv zunehmen. Entsiegeln kann man nur Verkehrsflächen, wenn man keine Häuser abreißen will. Der Platz ist begrenzt.
Der dritte Gamechanger ist der demografische Wandel. Der öffentliche Raum muss sicher und nutzbar sein für Menschen, die sich im engeren Umfeld bewegen müssen – Sport treiben oder spazieren gehen. Da ist die Frage zentral: Wie ist der Platz aufgeteilt? Stehen da nur Autos rum oder gibt es Platz für andere Dinge? Ein Blick in die Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes zeigt: Die Kilometerleistung pro Pkw sinkt seit Jahren, gleichzeitig steigen die Zulassungszahlen. Das heißt, die Autos stehen mehr rum und belegen Flächen. Wenn die nicht auf privaten Flächen stehen, blockieren sie den öffentlichen Raum – gerade in Städten ein Riesenproblem.
Wir danken für das Gespräch!
Werde ADFC-Mitglied!
Unterstütze den ADFC und die Rad-Lobby, werde Mitglied und nutze exklusive Vorteile!
- exklusive deutschlandweite Pannenhilfe
- exklusives Mitgliedermagazin als E-Paper
- Rechtsschutzversicherung
- Vorteile bei vielen Kooperationspartnern
- und vieles mehr
Dein Mitgliedsbeitrag macht den ADFC stark!

